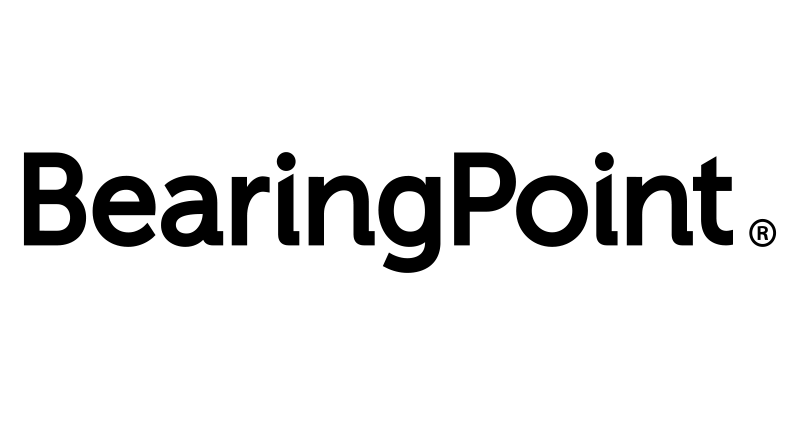Geht’s auch fair?
Textilproduktion in Europa – das klingt gut. Doch teilweise sind die Bedingungen schlechter als in asiatischen Ländern. Ein Report.


Abbildungen : © Clean Clothes Campaign (Bildquelle: Youtube )
• Der aktuelle Bad Boy der deutschen Bekleidungsbranche ist in letzter Zeit häufig in Portugal anzutreffen. Tom Illbruck, bis vor kurzem Gesicht und Geschäftsführer des Textilunternehmens Global Tactics aus Kerken am Niederrhein, hat in Guimaraes, nordöstlich von Porto, eine Firma gegründet. Sie soll die Keimzelle einer Bekleidungs-Wertschöpfungskette werden – vom Baumwollgarn bis zum fertigen T-Shirt, Hoodie oder Basecap. Alles zu fairen Bedingungen und nach Öko-Standards produziert, sagt der 43-Jährige. Eine kleine Näherei wird im November den Anfang machen, mit vielleicht sechs, sieben Mitarbeiterinnen. Büroräume sind schon angemietet. Jetzt fehlt noch ein Produktionsgebäude mit ein paar Nähmaschinen und einem großen Schneidertisch.
Diese Kollektion kann kostenlos gelesen werden dank
BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.
Ausgerechnet Illbruck, der im Mai in den Maskenskandal um den Influencer Fynn Kliemann verwickelt war. Global Tactics hatte für Kliemann Corona-Schutzmasken produzieren lassen – angeblich „unter fairen Bedingungen in Europa“, in Wirklichkeit aber in Bangladesch, das nach dem aktuellen Global Rights Index des Internationalen Gewerkschaftsbunds zu den „zehn schlimmsten Ländern der Welt für erwerbstätige Menschen“ zählt. Die in den dortigen Textilfabriken gezahlten Löhne und die Arbeitsbedingungen sind fast durchweg erbärmlich, immer wieder werden Arbeiterrechte verletzt, Proteste von der Polizei niedergeknüppelt und gewerkschaftliche Aktivitäten behindert oder verboten. Zu Global Tactics hat Illbruck mittlerweile alle Verbindungen gekappt. „Um das Unternehmen zu schützen“, sagt er. „Ich war nicht mehr tragbar.“ Es gibt einige Leute, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen.
Die Firmengründung in Portugal ist für Illbruck die logische Konsequenz aus dem Masken-Desaster, in das er nicht durch Zufall oder aus Unwissenheit reingeschlittert war, sondern das er selbst mitzuverantworten hatte. Er will nun sein Image verbessern, indem er als Textilproduzent vor Ort ist und nur noch mit Betrieben zusammenarbeitet, die umwelt- und sozialverträglich arbeiten. Die gesamte Lieferkette will er kontrollieren. Ob das dieses Mal zutrifft, wird sich zeigen – aber Illbruck weiß, dass man ihn genau beobachten wird.

Neuanfang nach dem Maskenskandal: der Textilunternehmer Tom Illbruck
Bei der Bezahlung soll der Unterschied zur Vergangenheit am stärksten spürbar werden. Tom Illbruck verspricht „faire und ordentliche Löhne, von denen die Leute leben können“. Die übliche Bezahlung in den portugiesischen Textilbetrieben kennt er. Der Mindestlohn beträgt aktuell 705 Euro bei 14 Gehältern jährlich, die in Portugal gesetzlich vorgeschrieben sind. „Wer 750 Euro zahlt, hat kein Problem, Näherinnen zu finden.“ Illbruck verspricht 860 bis 900 Euro, „das ist für Fabrikarbeit gutes Geld, damit kommt man in Portugal klar“. Auch wenn es für besondere Anschaffungen am Ende möglicherweise nicht reiche, räumt er ein.
Faire Produktion in Europa – das war schon das große Versprechen von Global Tactics. Aber Illbruck weiß, dass fair und europäisch nicht Hand in Hand gehen müssen. Das hat er früher, als er für deutsche Mode-Labels als Produktionsstätten-Scout unterwegs war, nur nicht so deutlich gesagt. Zwar ist Portugal ein EU-Land mit Arbeitszeitregelungen, die fast so streng sind wie in Deutschland. Aber genäht wird häufig in Heimarbeit, in Schuppen, Garagen und Hinterzimmern. Die Arbeitszeiten und -bedingungen sind da kaum zu kontrollieren.
Branchenkenner weisen schon länger auf die oft jämmerlichen Löhne und Arbeitsbedingungen bei Textilproduzenten in Europa hin, vor allem im Osten und Südosten, wo mehr als zwei Millionen Menschen für die Modeindustrie arbeiten. „Ausbeutungsbetriebe findet man auch in Nicht-EU-Ländern wie Serbien“, schrieb kürzlich der Geschäftsführer eines kleinen deutschen T-Shirt-Labels an brand eins. „Kaufkraftbereinigt wird in manchen Nähereien in Asien mehr bezahlt als in solchen Ländern.“
Auch Global Tactics ließ bislang in Serbien produzieren. Dort sei die Fertigung 10 bis 15 Prozent billiger als in Portugal, sagt Tom Illbruck. Seine Produzenten im Süden des Landes hätten Gehälter um 450 Euro gezahlt; in Belgrad, wo das Leben deutlich teurer ist, 100 Euro mehr. Besonders in Südserbien sei Lohndrückerei an der Tagesordnung, oft verdienten die Arbeiterinnen nicht mehr als 250 Euro pro Monat, 100 Euro weniger als der gesetzliche Mindestlohn.
Kann man ein T-Shirt aus Serbien oder Rumänien also nicht guten Gewissens kaufen? Wie vergleicht man Löhne und Arbeitsbedingungen zwischen Fabriken im selben Land, zwischen Ländern in Europa, zwischen Europa und Asien? Was ist ein fairer Lohn in Bangladesch, in Vietnam, in Portugal, in Moldawien? Reicht der staatlich festgesetzte Mindestlohn zum Überleben? Welche Hebel haben große und kleine Auftraggeber aus Europa, Löhne und Produktionsbedingungen in den Herstellungsländern zu beeinflussen? Und warum machen sie bislang offenbar so selten Gebrauch davon?

Produziert ausschließlich in Deutschland: Wolfgang Grupp, Inhaber des schwäbischen Sport- und Freizeitbekleidungsherstellers Trigema
Mindestlöhne: oft Hungerlöhne
Manchmal findet Silvia, eine junge Näherin in einer rumänischen Textilfabrik, ein wenig Trost darin, sich ein besseres Leben vorzustellen: „Gäbe es doch einen anderen Arbeitgeber hier in der Region“, wünscht sie sich dann, „einen, der wenigstens ein kleines bisschen besser bezahlt, dann würde jeder diese Fabrik hier verlassen. Jeder.“ Doch dann holt sie die Realität wieder ein. „Unsere Fabrik ist nun mal die einzige in dieser hoffnungslosen Gegend. Was soll bloß aus uns werden?“
Aktivistinnen und Aktivisten der Clean Clothes Campaign (CCC), einer niederländischen Nichtregierungsorganisation, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie einsetzt, haben Silvias Erzählung protokolliert. Die junge Frau, Mutter von zwei Kindern, berichtet von unangekündigten Überstunden, von Wochenendarbeit, von Vorgesetzten, die ständig zu höherem Arbeitstempo antreiben und von der 20-minütigen Mittagspause, in der die Arbeiterinnen schweigend ihr mitgebrachtes Dosenessen löffeln. Kein einmaliger Fall, sondern Alltag für Hunderttausende im Textil-Billiglohnland Rumänien, wo Modefirmen wie Benetton, C&A, Dolce & Gabbana, Esprit, H&M oder Hugo Boss ihre Kollektionen nähen lassen.
Recherchen der CCC belegen, dass die Textilproduktion vor allem im Osten und Südosten Europas meist das Gegenteil von fair ist. Die Organisation hat gerade wieder für jedes einzelne Land ausgerechnet, wie ein existenzsichernder Lohn bemessen sein müsste. Das wäre einer, mit dem eine Arbeiterin oder ein Arbeiter eine Familie mit zwei Kindern versorgen könnte. Dazu gehören die Grundbedürfnisse wie Essen, Miete, medizinische Versorgung, Ausbildung, Kleidung und Mobilität. Auch ein kleines Budget für Notfälle oder Situationen wie die Coronakrise, wo viele Beschäftigte in unbezahlten Urlaub geschickt wurden. Das Ergebnis der Berechnungen für das Jahr 2021 ist entlarvend: In Serbien etwa entsprach der monatliche Netto-Mindestlohn von 275 Euro, an dem sich das Gros der Textilbetriebe orientiert, nur wenig mehr als einem Viertel des existenzsichernden Lohns von 976 Euro. In Bulgarien lag der Mindestlohn bei einem Fünftel, in Moldawien bei einem Siebtel. Selbst in Ungarn, der Slowakei, Polen und Kroatien, die schon lange nicht mehr als Billiglohnländer gelten, erreicht der Mindestlohn bestenfalls ein Drittel. Im Vergleich geht es den Textilarbeiterinnen in Moldawien somit nicht besser als denen in Bangladesch, die Lohnlücke in Rumänien ist sogar größer als in Indien oder Vietnam.
Die Zahlen der CCC gelten als gründlich recherchiert und werden von den Modekonzernen, die in Ost- und Südosteuropa produzieren lassen, nicht in Zweifel gezogen. „Modehäuser haben jetzt einen konkreten Richtwert“, sagt die Ökonomin Bettina Musiolek, die die existenzsichernden Löhne für Europa mit berechnet hat. „Sie können sich nicht mehr damit herausreden, dass sie ja den im Land gültigen Mindestlohn bezahlen.“ Große Modeketten wie H&M oder Inditex (in Deutschland bekannt durch seine Tochter Zara) beteuern seit Jahren, dass sie sich auf anständige Löhne zubewegen wollen, doch konkrete Schritte lassen sie bisher vermissen. David Hachfeld von der Schweizer Organisation Public Eye, die eng mit der CCC kooperiert, sagt: Statt Zeitpläne mit klaren Zielvorgaben vorzulegen, „zeigen sie lieber mit dem Finger auf andere und beklagten, dass es branchenweite Initiativen bräuchte, damit sich etwas bewegt“.
Made in Schwaben
Wolfgang Grupp interessiert sich nicht so sehr dafür, welchen Lohn eine Näherin in Rumänien oder Bangladesch nach Hause bringt. Muss er auch nicht. Der meinungsstarke Inhaber des schwäbischen Sport- und Freizeitbekleidungsherstellers Trigema produziert ausschließlich in Deutschland. „Ich garantiere hier seit 53 Jahren die Arbeitsplätze“, dröhnt er durchs Telefon. „Auch in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit.“ Made in Germany ist bei Trigema wie in Stein gemeißelt. Nicht die Produkte definieren den Markenkern, sondern die Produktion mit 1200 Beschäftigten auf der Schwäbischen Alb.
Grupp verweist auf seine früheren Wettbewerber, auf Schiesser, Jockey und Götzburg, die schon vor 20, 30 Jahren ihre Produktion ins Ausland verlagerten, weil sie Lohnkosten sparen wollten und auf kurz oder lang in die Insolvenz schlitterten, weil die Versand- und Kaufhausriesen die Preise immer weiter nach unten drückten, worunter die Qualität litt.
Der kantige schwäbische Unternehmer, mittlerweile 80 Jahre alt, ist konsequent einen Sonderweg gegangen. „Das habe ich aus Verantwortung für mein Heimatland getan“, sagt er. „Ich kann doch die Menschen, deren Mütter und Großmütter schon hier gearbeitet haben, nicht im Stich lassen.“ In Burladingen, dem Firmensitz von Trigema, gab es einst 26 Textilfirmen, bis auf Wolfgang Grupps Unternehmen sind alle untergegangen. Trigema macht alles, von der Stoffherstellung über das Bleichen und Färben bis zum Zuschnitt, Nähen, Besticken oder Bedrucken.
Grupp sieht sich als Vorbild für andere aus der Branche – doch die ist arg geschrumpft, viele Betriebe und Berufe gibt es nicht mehr, außer eben bei ihm. Selbst er hat ja hier und da Probleme. Es gebe so gut wie keine Spinnereien mehr, sagt Grupp – weil die Abnehmer der Garne schon vor Jahrzehnten Insolvenz angemeldet haben. Also lässt er das Garn für Shirts und Unterwäsche seit Jahren vor allem in Griechenland spinnen. Aber was weiß der Mann, der Wert darauf legt, dass jeder seiner Beschäftigten genug verdient, über die Löhne und Arbeitsbedingungen beim griechischen Produktionspartner? Da bleibt Wolfgang Grupp dann doch lieber im Ungefähren. „Wir brauchen Garn bester Qualität“, sagt er. „Und dafür brauchen Sie motivierte und zuverlässige Mitarbeiter. Die haben Sie nicht, wenn Sie ihnen schlechte Löhne zahlen oder sie sonst wie drangsalieren.“ Außerdem – „so etwas würde sich ganz schnell in der Branche herumsprechen“.

Vaude produziert den Großteil seiner Produkte in Asien und überprüft die Arbeitsbedingungen vor Ort regelmäßig; Foto: © VAUDE
Dass nach der Maskenaffäre ein solcher Shitstorm über Fynn Kliemann niederging, erfüllt Grupp mit einer gewissen Genugtuung. Auch Trigema hatte die Produktion zu Beginn der Pandemie eine Zeit lang weitgehend auf Schutzmasken umgestellt und damit Kurzarbeit vermieden. Zehn Masken für 120 Euro, ein stolzer Preis. Kliemann warf Grupp daraufhin vor, sich an der Corona-Krise zu bereichern. „Wir produzieren auch in Europa zu fairen Löhnen“, ätzte er. „Aber wir kriegen das auf jeden Fall deutlich günstiger hin.“ Heute wisse man, dass Kliemanns Masken „nur so billig waren, weil er sie in Bangladesch produzieren ließ“, sagt Grupp.
Anzeige
Wir stehen für Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum (NEW)
Wir sind überzeugt, dass die Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit eine große Chance für Unternehmen bietet. Um sie zu nutzen, sollten Führungskräfte der ganzheitlichen Nachhaltigkeitstransformation höchste Priorität einräumen: Jetzt gilt es, Menschen zu befähigen und Ressourcen für die Umsetzung zu mobilisieren. Für uns, für die Gesellschaft, für unseren Planeten.
Bleiben oder gehen?
Ein ganz anderes Problem hat der Outdoor-Spezialist Vaude. Das Unternehmen aus Tettnang am Bodensee lässt – über einen taiwanesischen Partner – einen sehr kleinen Teil seines Sortiments in Myanmar produzieren. Bisher, so Jan Lorch, in der Geschäftsführung verantwortlich für Vertrieb und Nachhaltigkeit, „sind wir bewusst dort geblieben, um unserer sozialen Verantwortung nachzukommen“. Die Fabrik biete sehr gute Arbeitsbedingungen, „die wir vor Ort regelmäßig überprüfen.“ Auch vonseiten der Fair Wear Foundation (FWF) – einer unabhängigen Stiftung, die die Zustände in den Fabriken verbessern will und jährlich die Arbeitsbedingungen kontrolliert –, gab es bislang keine Einwände gegen die Produktion in Myanmar. Vaude habe außerdem dafür gesorgt, dass es in der Fabrik Unterstützung bei der Gesundheitsversorgung sowie eine „hochwertige komplette Verpflegung für die Arbeiterinnen“ gibt. „Wenn wir rausgehen aus Myanmar, fällt das alles weg.“
Der Militärputsch im Februar 2021, gefolgt von einer Welle willkürlicher Verhaftungen, Morden und Folter, hat die Situation für Vaude dramatisch verändert. Im Ranking des Internationalen Gewerkschaftsbunds zählt auch Myanmar mittlerweile zu den „zehn schlimmsten Ländern der Welt“ für Arbeitnehmer. Man beobachte die Situation sehr genau, sagt Lorch. „Bei einer weiteren Verschlechterung der Lage oder wenn die Fair Wear Foundation ihre Haltung zur Produktion in Myanmar ändert, müssen und werden wir Konsequenzen ziehen.“
Vaude will beweisen, dass es geht: weltweit zu fairen Bedingungen produzieren. Die Firma, die zwischen 80 und 90 Prozent ihrer Produkte in Asien fertigen lässt, ist seit zwölf Jahren FWF-Mitglied; mittlerweile rangiert Vaude in der Top-Kategorie. Bei der jüngsten jährlichen Überprüfung erreichte der deutsche Outdoor-Ausrüster 91 von 100 möglichen Punkten. Zusätzlich zu den FWF-Audits ist Vaude regelmäßig mit eigenen Leuten vor Ort und kontrolliert, ob Arbeitszeiten, Pausen und Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden und ob es Pausenräume und saubere Toiletten gibt. Potemkinsche Dörfer würden entlarvt, ist Geschäftsführerin Antje von Dewitz überzeugt. „Unsere Teams schauen in die laufende Produktion, sie gehen bis an die Linie, an die Arbeitsplätze der Näherinnen.“
Der entscheidende Punkt ist und bleibt die Bezahlung. Vaude hat sich verpflichtet, sich „in Richtung existenzsichernder Löhne zu bewegen“. Seit dem vorigen Jahr existiert ein „Fahrplan zum Existenzlohn“. Wie weit ist man vorangekommen? „Wir sind bei etwa 70 Prozent“, schätzt Jan Lorch. Die Fair Wear Foundation sieht noch Handlungsbedarf: „Für seine Lieferanten außerhalb Vietnams hat Vaude noch keine Lohnziele definiert“, bemängelt die Stiftung. Das gab Abzüge bei der Bewertung.
Einen Teil der Lücke zum existenzsichernden Lohn hat inzwischen der Markt geschlossen. Im Süden und Südosten von China, wo Vaude produzieren lässt, ist die Konkurrenz um Arbeitskräfte mittlerweile so groß, dass viele scharenweise in die Automobil- und Elektroindustrie abwandern, die besser bezahlt als die Textilfabriken. „Wenn Sie da keine guten Löhne, Kantinenessen und Sportangebote bieten, sind Ihre Arbeitskräfte woanders“, sagt Lorch. Ähnlich in Vietnam, mit 65 Prozent des Produktionsvolumens das bedeutendste Herstellungsland für Vaude. Bei Hanoi lässt das Unternehmen Rucksäcke fertigen. Seit Samsung vor einigen Jahren ganz in der Nähe eine große Smartphone-Fabrik eröffnet hat, sind auch dort die Löhne kräftig gestiegen.
Trotzdem geht es insgesamt nur mühsam voran. In vielen Fällen fehlen den europäischen Firmen schlicht die Hebel, etwas in Bewegung zu setzen – es sei denn, es handelt sich um Konzerne, die mit ihren Aufträgen eine Fabrik komplett auslasten. Das ist aber die Ausnahme. In den meisten Fällen mangelt es an Relevanz. Bei Vaude etwa, so Jan Lorch, „bewegt sich der Anteil am gesamten Ordervolumen der Produktionsbetriebe immer im einstelligen Bereich“. Da ist es schwer, die Fabrikbesitzer zu besserer Entlohnung zu drängen.
„Die Näherei sagte: ‚Ihr habt doch alle Zertifikate, die ihr braucht, warum wollt ihr denn jetzt auch noch mehr bezahlen? Mit so hohen Löhnen schießen wir uns aus dem Wettbewerb.‘“
Vor allem das branchenübliche „heute hier, morgen fort“ zementiert die alten Verhältnisse. Gerade bei simplen Produkten wie T-Shirts tauschen die Mode-Labels ihre Hersteller schnell aus, beim Einkauf zählt Flexibilität. „Kein Produzent, egal ob in Bangladesch oder in Rumänien, wird sich Vorgaben beim Lohn machen lassen, wenn der Kunde sich nicht auf eine langfristige Zusammenarbeit festlegen will“, sagt David Hachfeld von Public Eye. „Im nächsten Jahr wechselt der Kunde dann zu einem noch billigeren Produzenten, und der Nähereibesitzer steht da mit einem im Vergleich zur Konkurrenz zu hohem Lohnniveau.“
Vaude hat deshalb in den vergangenen Jahren die Zahl seiner asiatischen Lieferanten reduziert und setzt mittlerweile bei 80 Prozent seiner Aufträge an externe Produzenten auf langfristige Beziehungen mit höherem Auftragsvolumen, das den Fabrikbesitzern mehr Planungssicherheit bietet. „Dadurch gewinnen wir etwas mehr Einfluss“, sagt Antje von Dewitz.
Auch Vaude beendet hin und wieder eine Geschäftsbeziehung mit einem Produzenten – allerdings nicht, um zum nächsten billigeren zu ziehen, sondern weil es bei der Behebung von Mängeln nicht vorangeht. Bei der jüngsten Überprüfung etwa stellte die FWF in einigen chinesischen Fabriken eine exzessive Anhäufung von Überstunden fest. Dann gibt es einen „Corrective Action Plan“ und ernste Gespräche. „Aber wenn wir keine Veränderungsbereitschaft sehen und einfach nichts passiert“, sagt Jan Lorch, „müssen wir irgendwann auch Konsequenzen ziehen.“
Der lange Weg zum Öko-Shirt
Drei Freunde traten vor 16 Jahren mit dem Vorhaben an, das beste T-Shirt der Welt herzustellen: langlebig, mit perfekter Passform, tollen Motiven und umweltfreundlich hergestellt. Ihr kleines, in Konstanz beheimatetes Mode-Label, nannten sie fortan 3Freunde. Die ersten Exemplare, noch aus konventionell angebauter Baumwolle, ließen sie in der Türkei fertigen. Schnell wurde ihnen klar, „dass so ein T-Shirt mehr ist als ein cooles Endprodukt“, sagt Stefan Niethammer, 48, damals Gründer und heute Geschäftsführer. Also wechselten sie erst auf Bio-Baumwolle. Dann stellten sie in Indien eine komplett zertifizierte Produktionskette zusammen, mit Baumwoll-Kooperativen, Strickerei, Spinnerei, Färberei, Näherei.
Als nächsten Schritt wollten sie zu den ersten Mode-Labels gehören, die dafür sorgen, dass ihre Produzenten existenzsichernde Löhne zahlen. Doch hier ging es nicht voran. „Die Näherei, mit der wir arbeiteten, verstand das Problem nicht“, erinnert sich Stefan Niethammer. „Sie sagten: ‚Ihr habt doch alle Zertifikate, die ihr braucht, warum wollt ihr denn jetzt auch noch mehr bezahlen? Mit so hohen Löhnen schießen wir uns aus dem Wettbewerb.‘“
Es gab nur einen Ausweg: 2012 gründete 3Freunde in Indien eine eigene kleine Näherei mit heute zehn Beschäftigten. Ein harter Kampf sei es gewesen, sagt Niethammer. „Wir hatten manchmal nur Aufträge für vier Wochen und dann wieder keine. Also mussten wir andere Kunden reinnehmen, die bereit waren, Existenzlöhne zu zahlen.“ Der Kreis der Kandidaten sei sehr überschaubar gewesen. Richtig schwierig wurde es in der Pandemie. Ein neuer Kunde rettete die kleine Näherei: Für den Kondom- und Periodenprodukthersteller Einhorn fertigt 3Freunde seitdem kleine Täschchen für Menstruationstassen – ein Produkt ohne große saisonale Schwankungen. Das gibt Produktionssicherheit.
Dass 3Freunde in ihrer eigenen Näherei als eines von wenigen Mode-Labels seit zehn Jahren anständige Löhne zahlt, macht Stefan Niethammer ein wenig stolz. Je nach Erfahrung und Betriebszugehörigkeit sind es umgerechnet zwischen 330 und 400 Euro pro Monat, das ist mindestens das Dreifache des Mindestlohns und ein Drittel mehr als der von der Global Living Wage Coalition berechnete existenzsichernde Lohn für Indien. Allerdings sind mit dem Gehalt, das die Firma zahlt, 20 Überstunden pro Monat mit abgegolten. „So einen Schritt könnten sich andere auch mal überlegen“, sagt Niethammer.
Aber er weiß auch, wo die Grenzen sind. „Auf die Löhne in der Färberei haben wir überhaupt keinen Einfluss“, sagt er. „Da bewegen wir uns bei der Auslastung im Promillebereich.“ Die „absolute Blackbox“ sei die Spinnerei. 3Freunde habe sich sehr viele Gedanken gemacht, von welcher Baumwollkooperative sie ihre Bio-Baumwolle beziehen. „Natürlich sagt die Spinnerei: ‚Ja, die Baumwollballen dort in der Ecke kommen genau von der Kooperative.‘ Aber ob das wirklich immer stimmt – also ich würde dafür meine Hand nicht ins Feuer legen.“ ---
Weiterführende Links von BearingPoint
Anzeige
Sustainability bei BearingPoint
Unser Nachhaltigkeitsbericht zeigt Ziele und Fortschritte, die wichtigsten Aktivitäten und Kennzahlen auf.
Anzeige
Veröffentlichungen im Kontext Nachhaltigkeit
Hier finden Sie ausgewählte Veröffentlichungen von BearingPoint rund um das Thema Nachhaltigkeit.